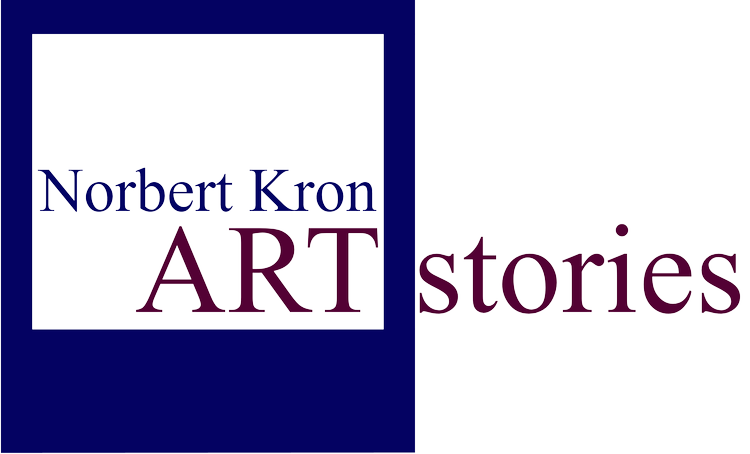Mein Stilbruch-Beitrag zum Holocaust-Gedenktag ist in der RBB-Mediathek (hier klicken) sechs Monate online.
Ich mache mich auf Spurensuche. Antisemitismus in Deutschland? In letzter Zeit häufen sich alarmierende Nachrichten, gerade in Berlin: Auf einer Anti-Trump-Demo verbrennen Demonstranten in Neukölln eine selbstgebastelte Israelfahne. In Schöneberg wird ein jüdischer Gastronom auf offener Straße von einem Anwohner übelst beschimpft.
O-Ton unbekannter Berliner: "Du kriegst deine Rechnung. Du kriegst deine Rechnung."
Keine Einzelfälle, wie Wenzel Michalski von Human Rights Watch aus eigener Erfahrung weiß. Als er mit der Geschichte seines Sohnes an die Öffentlichkeit ging, hörte er von vielen jüdischen Bekannten, dass sie ganz ähnliche Anfeindungen erlebt haben.
Wenzel Michalski, Human Rights Watch: "Mein Sohn wurde an der Friedenauer Gemeinschaftsschule über viele Wochen, über drei Monate hinweg antisemitisch angegriffen. Verbal, aber auch körperlich. Er wurde angerempelt, geschlagen, er wurde gewürgt, es wurde eine Scheinhinrichtung an ihm verübt. Das war für uns ein Schock. Nach dieser Scheinhinrichtung mit einer Replica-Pistole, also mit einer täuschend echten Kopie einer Pistole, haben wir ihn dann von der Schule genommen."
Der Vorfall ist nur die Spitze des Eisbergs in einem deutschen Schulalltag, bei dem das Schimpfwort "Ey, du Jude" immer öfter zu hören ist. Die Schulleitungen scheinen hilflos, wie Wenzel Michalski erfährt, als er den Dialog sucht.
Wenzel Michalski, Human Rights Watch: "Wir wollten an der Schule ja mit denen sprechen. Aber die Schule hat gesagt: Das hat gar keinen Zweck. Es handelt sich da um Moslems. Deswegen brauchen wir da gar nicht da erst gar nicht anzufangen."
Ist der verstärkte Antisemitismus also ein importiertes Islam-Problem? Studien bestätigen, dass die Vorurteile bei Muslimen kulturell verankert sind. Aber gibt es da kein Rankommen? Der junge Islamwissenschaftler Iskandar Abdallah findet, dass man differenzieret vorgehen muss: Den Dialog suchen auf der einen Seite, und auf der anderen: striktes Durchgreifen.
Iskandar Ahmad Abdalla, Salaam-Shalom-Initiative: "Ich kann Gewalt nicht dulden und akzeptieren. Das heißt, da müssen Maßnahmen getroffen werden. Ich weiß nicht, wie diese Maßnahmen an den Schulen normalerweise aussehen, aber: über Strafmaßnahmen oder Noten."
In seiner Freizeit begleitet Iskandar Abdalla Schulklassen zu Holocaust-Gedenkstätten. Damit hat er gute Erfahrungen gemacht. In der aktuellen Antisemitismus-Debatte warnt er davor, die Muslime zum Sündenbock zu machen.
Iskandar Ahmad Abdalla, Salaam-Shalom-Initiative: "Ich glaube, dadurch blendet man den Antisemitismus aus, der in der Mitte der Gesellschaft existiert, der sich nicht immer so verbal und aggressiv äußerst, aber der typisch wie antisemitischer Antisemitismus eher struktureller Natur ist."
Stimmt das? Ist Antisemitismus auch in der angeblich so aufgeklärten Mehrheitsgesellschaft salonfähig? Statistiken beweisen, dass die Delikte auch im rechten Milieu angestiegen sind. Doch bedrohlicher ist, wie verbreitet Klischees über Juden bei den sogenannten ganz normalen Deutschen sind, meint die Berliner Schriftstellerin Mirna Funk. Sie erlebt das ständig, davon handelt auch ihr Roman "Winternähe".
Mirna Funk, Schriftstellerin: "Mit ist ehrlich gesagt egal, woher der Antisemitismus kommt. Genauso wie wir versuchen müssen, antisemitische Vorurteile und diesen Hass in Deutschland unter Deutschen abzubauen, muss er auch bei Muslimen oder bei wem auch immer abgebaut werden."
Greift die bisherige Gedenkkultur nicht mehr? Brauchen wir KZ-Pflichtbesuche für alle? Mirna Funk hält Erinnerungsarbeit für wichtig - und Gespräche, wie sie sie nun am Berliner Ensemble zum Holocaust-Gedenk-Tag veranstaltet. Doch die Aufklärung müsse noch früher beginnen.
Mirna Funk, Schriftstellerin: "Dann muss auch etwas strukturell in Schulen passieren. Es kann nicht sein, dass man immer nur von Leichen und toten Juden hört und in KZs geht, aber überhaupt nicht erfährt, dass es jüdisches Leben gibt. Und ich glaube auch, dass solche Sachen wie eine Klassenfahrt nach Tel Aviv vermutlich mehr Sinn macht als ein KZ-Besuch."
Wie sehr es hilft, wenn Schüler das bunte, vielseitige Leben in Israel kennenlernen, das weiß Christine Mähler vom Deutsch-Israelischen Jugendaustausch ConAct. 7.000 junge Leute entdecken jedes Jahr das Land und schließen Freundschaften.
Christine Mähler, Deutsch-Israelischer Jugendaustausch: "Die jungen Menschen kommen zusammen, treffen aufeinander und merken erst einmal, sie haben ganz viel gemeinsam, Mode, Musik, Medien. Es gibt gibt ganz viel Verbindendes. Insofern ist es auch ein Anliegen, junge Menschen mit muslimischem oder türkischem Hintergrund in diesen Austausch einzubeziehen. Das ist auch ein Projekt, an dem wir gerade intensiv arbeiten."
Die Erlebnisse, die junge Leute bei Israelreisen machen, können sie nun auf der Website von ConAct veröffentlichen, das Christine Mähler nach dem Vorbild der Anthologie "Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen", die Amichai Shalev und ich 2015 herausgegeben haben, mit Hilfe des Familienministeriums realisiert hat. Die besten Geschichten werden im Juni prämiert. Ich finde, Initiativen wie diese müssen unser Holocaust-Gedenken in Zukunft noch viel stärker ergänzen.